Presseaussendungen
Prodinger Gruppe gründet neuen Geschäftsbereich
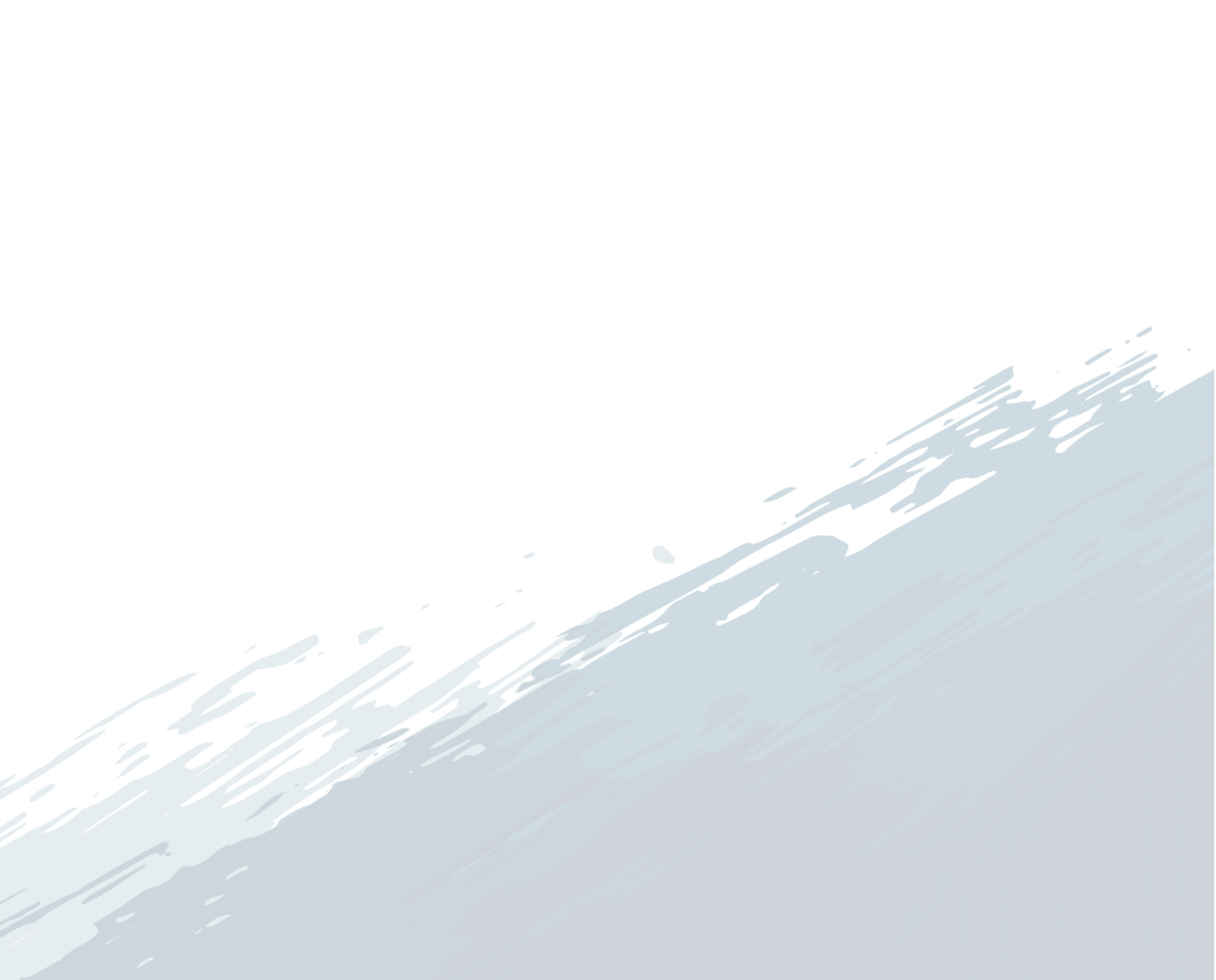
Die Prodinger Gruppe geht gemeinsam mit ihren Kunden unerschrocken neue Wege in der Unternehmensführung und Unternehmensentwicklung. Dies umfasst sowohl die Teilbereiche Steuerberatung, Unternehmensberatung, als auch Marketing und Digitalisierung. So schaffen wir ganzheitliche, oft generationsübergreifende Lösungen, die so individuell sind, wie die Herausforderungen, denen sich der Mittelstand stellen muss.
Die Prodinger Gruppe betreut Kunden sämtlicher Branchen. Die äußerst positive wirtschaftliche Entwicklung in Österreich in den letzten Jahrzehnten führt dazu, dass bestehende Betriebe gewachsen und neue entstanden sind. Diese Entwicklung im Tourismus, im Bau- und Immobiliensektor, im Handel und bei den Dienstleistungen dürfen wir als Steuerberater aktiv begleiten und unterstützen. Unsere Kunden schätzen dabei die fundierte Beratung und die Größe der Prodinger Gruppe bei gleichzeitig individueller und persönlicher Betreuung. Und natürlich das gute Gefühl, in Prodinger einen etablierten Partner zu haben, der die Flexibilität eines Kleinunternehmens mit der Sicherheit und Kompetenz eines großen Unternehmens vereint.
Wir alle verbringen einen beträchtlichen Teil unseres Lebens in der Arbeit. Umso wichtiger ist es, dies in einem guten Umfeld zu tun, in einem engagierten Team, und für inspirierende, abwechslungsreiche Kunden.
Wir setzen auf Vorsprung durch Qualität und Personalentwicklung. Investitionen in die Aus-und Weiterbildung haben bei uns einen hohen Stellenwert.
Freie Stellen
Prodinger Gruppe gründet neuen Geschäftsbereich
Der Pinzgauer Fußballcampus
Achtung bei Mitarbeiterwohnungen
Wie kann Mitarbeiterloyalität auch in Kleinunternehmen gefördert werden?